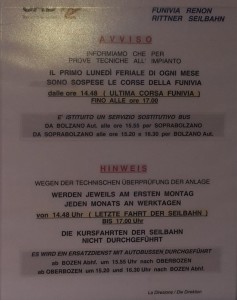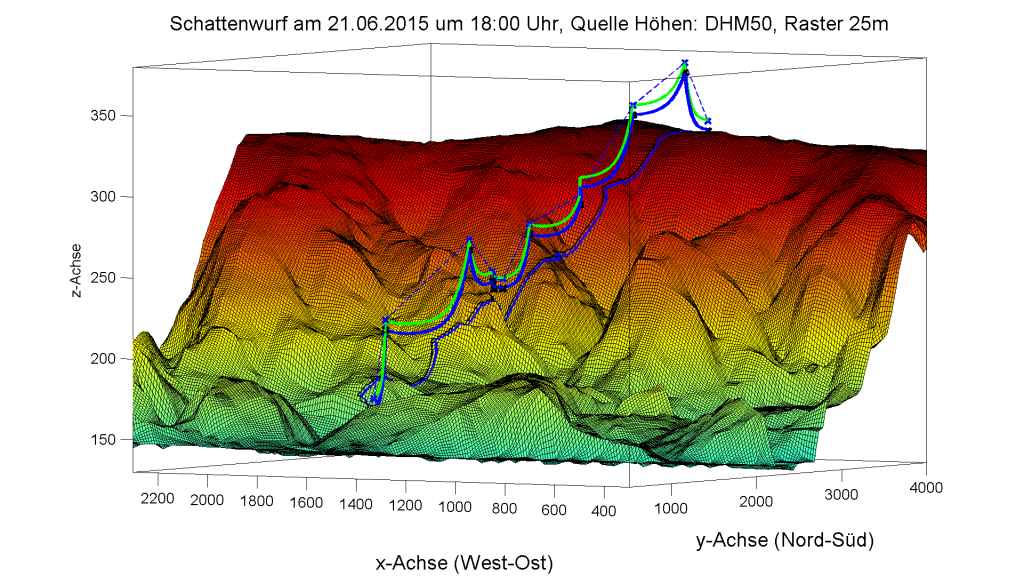Herr Jung hat der Cronenberger Woche vom 28./29.08.2015 ein bemerkenswertes Interview gegeben, in dem er sich auch zu dem Seilbahnprojekt nochmals positioniert hat:
Ich sehe die Seilbahn als eine große Chance. Ich glaube, wir diskutieren in diesem frühen Stadium schon viel zu sehr um Einzelfragen. Viele große Fragen sind noch zu lösen, bevor man in ein Planfeststellungsverfahren einsteigen kann. Die Finanzierung ist ohne die entsprechenden öffentlichen Zuschüsse überhaupt nicht denkbar. Deshalb müssen wir zunächst darum kämpfen, dass der VRR die Finanzierung zum großen Teil übernimmt. Ich habe großes Verständnis für diejenigen, die davon direkt betroffen sind. Ich glaube aber, dass sich die Proteste derjenigen relativieren, die nur kritisieren, dass über ihr Haus geschwebt wird. Ich glaube, das wird irgendwann keiner mehr wahrnehmen. Ich denke, wenn wir nicht in Wuppertal eine solche Chance nutzen, da wir hier einmal so etwas Bahnbrechendes gebaut haben wie die Schwebebahn, wo sollte das dann entstehen. Wer die Busse sieht, die sich morgens durch die Südstadt quälen, der muss doch sagen: Es ist aller Mühen wert, das Seilbahn-Projekt zu versuchen, die das alles viel erträglicher machen würde.
Meint Herr Jung allen Ernstes, dass Gondeln in der Größe von Kleinbussen, die alle 16 Sekunden in ca. 20 Metern über privaten Grundstücken fliegen, irgendwann nicht mehr wahrgenommen werden ?
Wann werden die „vielen großen Fragen“ geklärt ? Müsste das nicht vor einem Ratsbeschluss zu einem Planfeststellungsverfahren erfolgen ?
Wer wie OB Jung die Ziele und Argumente der BI „Keine Forensik auf Lichtscheid“ unterstützt, kann nicht gleichzeitig die Kritik von Anwohnern der Südstadt kleinreden !
Das komplette Interview kann hier nachgelesen werden. Die Gesamtausgabe der Cronenberger Woche vom 28./29.08.2015 kann unter diesem Link aufgerufen werden.