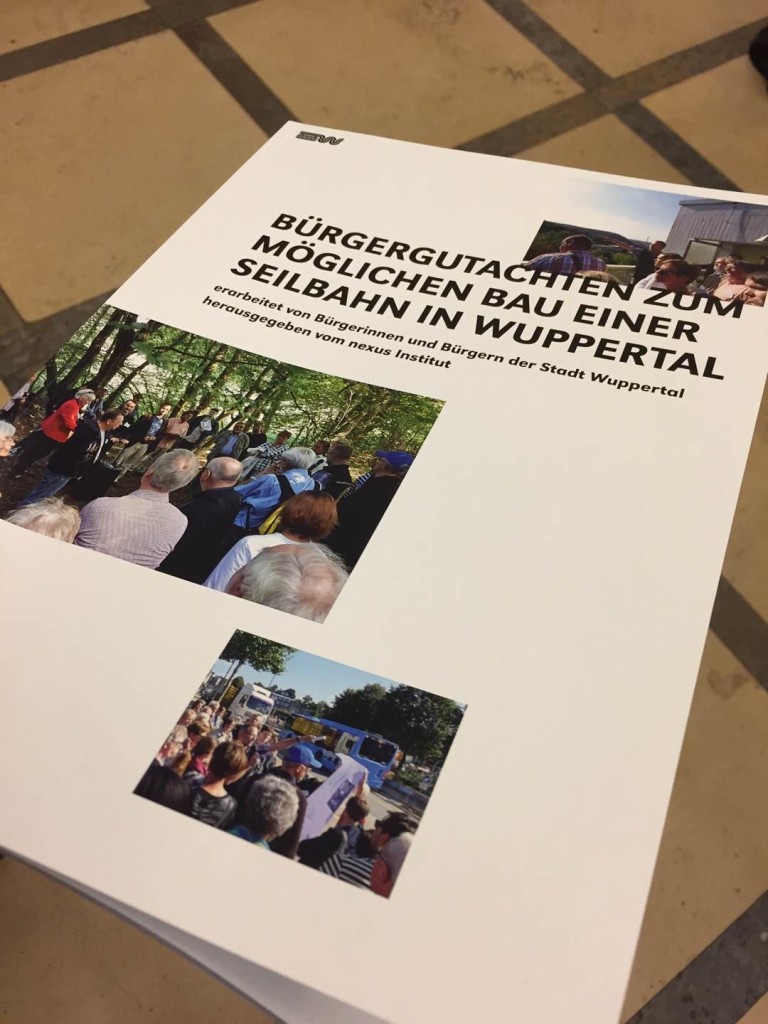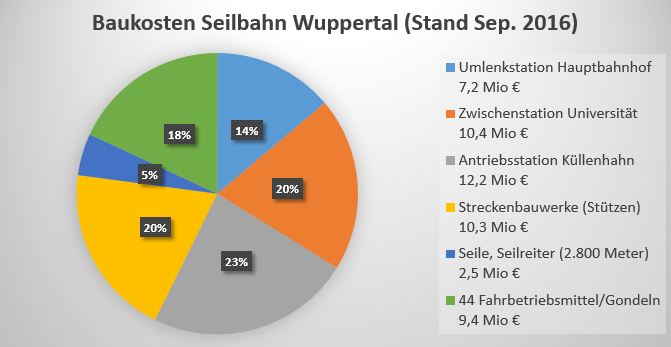Wie die Internetseite Citylab.com berichtet, gibt es Ideen, auch in Paris Seilbahnen für den öffentlichen Personennahverkehr zu bauen. Dabei wird im Artikel Can the Paris Gondola Succeed Where London’s Failed? (Kann die Seilbahn in Paris erfolgreich sein, auch wenn die Bahn in London gescheitert ist?) ein Vergleich zur Emirates Air Line in London herangezogen. Die dortige Anlage wird im Artikel als Enttäuschung bezeichnet. Darüber hinaus wird aufgezeigt, welche Fehler in London gemacht wurden.
Im Artikel wird an erster Stelle erwähnt, dass die Seilbahn in Paris keine Touristenattraktion werden soll. Die Fahrgastzahlen der Emirates Air Line zeigen, dass eine Seilbahn allein nicht als Touristenattraktion funktioniert. Die Emirates Air Linie ist weit von den bekannten Attraktionen Londons entfernt. In ihrem direkten Umfeld findet man kaum Interessantes für Touristen.
Die Emirates Air Line beweist, dass kaum Touristen eine Seilbahn nutzen, nur weil es eine Seilbahn ist. Seilbahnen können sich als Touristen-Magnet entwickeln, wenn an Sie interessante Punkte miteinander verbinden. In Koblenz beispielsweise wird der Bereich der Rheinpromenade mit dem bekannten Deutschen Eck direkt mit der Festung Ehrenbreitsten verbunden. Die alte Festung ist ein Weltkulturerbe. Es gibt Restaurants, Spielplätze und eine Aussichtsplattform mit Blick über das Deutsche Eck und die Innenstadt von Koblenz. Außerdem finden an und in der Festung über das Jahr verteilt mehrere Veranstaltungen und Konzerte statt.
Ein weiteres Beispiel ist Funchal (Madeira). Dort wird die Stadt mit dem auf einem Berg liegenden botanischen Garten mit einer Seilbahn verbunden.
In Südtirol führt die Rittner Seilbahn von der Bozener Innenstadt nach Oberbozen. Dort gibt es zahlreiche Wanderwege, die bekannten Erdpyramiden und einem direkten Anschluss an die Rittner Bahn, eine Schmalspurbahn die mit teilweise historischen Zügen über das Rittner Plateau führt.
In Koblenz, Funchal und Bozen verbinden die Seilbahnen interessante Punkte. Im Gegensatz zur Seilbahn in London sind sie deshalb auch für Touristen interessant.
Wie wird das Thema Tourismus bei Projektplanern der Seilbahn Wuppertal gesehen? Auf der Projekt-Website Seilbahn2025.de finden sich hierzu folgende Aussagen,
Ferner spricht die Seilbahn Touristen an.
Kommentar zur Aussage „Potential Schüler vom Schulzentrum Süd nicht ausreichend“
(www.seilbahn2025.de/faq, abgerufen am 22. Oktober 2016)
Ergänzend hierzu wird die Seilbahn zum Beispiel Familien und von der Technik begeisterte Tagesausflügler anziehen. Man schwebt hinab in Tal mit Blick auf Wuppertal und rundet damit etwa einen Tag im Wuppertaler Zoo ab.
Antwort auf die Frage „Was macht die Seilbahn attraktiv für Touristen?“
(www.seilbahn2025.de/faq, abgerufen am 22. Oktober 2016)
Auch wenn erwähnt wird, dass Tourismus nur ein Nebeneffekt der Seilbahn wäre, wird trotzdem häufig damit für die Seilbahn argumentiert. Man sollte sich allerdings die Frage stellen, welchen Grund Touristen haben sollten, die Seilbahn zu nutzen. Weder an der Mittel- noch an der Bergstation gäbe es in der näheren Umgebung attraktive Anziehungspunkte. Wuppertaler Attraktionen wie der Zoo, der Skulpturenpark , die Hardt mit dem botanischen Garten oder die Barmer Anlagen lägen weit von der Seilbahntrasse entfernt.
Übrigens: Citylab.com zählt in genanntem Artikel noch weitere Punkte auf, die dazu führen, dass die Seilbahn in London eine enttäuschende Auslastung hat. Es soll einiges in Paris besser gemacht werden. Vergleichen wir die Punkte jedoch mit Wuppertal:
Die Seilbahn in Paris wird nicht parallel zu vorhandenen Verkehrssystemen fahren
In Wuppertal würden die meisten Buslinien, die parallel zur aktuell diskutierten Strecke führen weiter betrieben, allerdings seltener als heute fahren.
Die Seilbahn in Paris würde ein echtes Problem lösen
Mit „Problem“ ist eine Lücke im ÖPNV gemeint. Es sind weite Strecken an Schnittstellen zwischen U-Bahn und Vorortzug zu Fuß zurückzulegen, die mit einer Seilbahn verbunden werden könnten. In Wuppertal soll die Seilbahn vorrangig die Anbindung der Universität verbessern. Doch es existiert bereits eine flexible Busverbindung zwischen der Innenstadt und der Universität, die durch die Seilbahn lediglich abgelöst würde.
Die Seilbahn ist nicht der einzige Ansatz, um die Transportprobleme von Paris zu lösen
Die Seilbahnen in Paris währen ein Bestandteil eines ganzen ÖPNV-Konzepts. Unter anderem beinhaltet dieses Konzept auch eine deutliche Erweiterung des Metro-Netzes. In Wuppertal würde eine Verbindung geschaffen, die nur für einen Teil der Wuppertaler interessant wäre. Allerdings würde die Seilbahn Fördermittel binden und damit den Ausbau des restlichen ÖPNV-Netzes bremsen.
Das Webportal Citylab.com bestätigt in genanntem Artikel somit im Wesentlichen die Argumente gegen eine Seilbahn in Wuppertal.